Ramses Kartusche |
Namenskartusche der Kleopatra auf dem Obelisken aus Phila. Sie enthält 4 Buchstaben, die auch auf der Ptolomäuskartusche erscheinen: P, T, O, L |
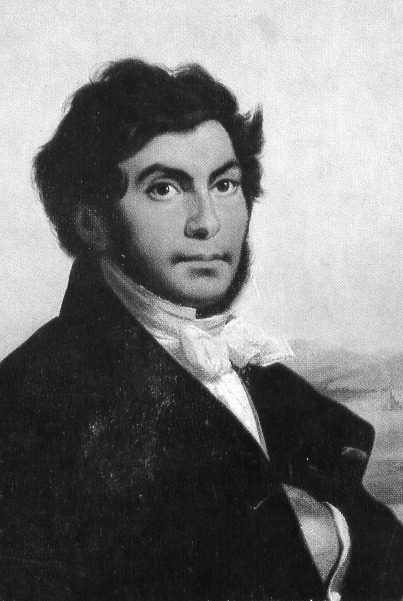
Schon seit frühester Kindheit vom Phänomen der Hieroglyphen begeistert, wollte Jean-François Champollion Youngs Erkenntnisse fortführen. Als zweiter Sohn einer Buchhändlerfamilie galt er sehr früh als Sprachgenie, der sich autodidaktisch das Schreiben beibrachte und noch vor seiner Schulzeit Untersuchungen an der Bibel anstellte, indem er das Schriftbild mit der gesprochenen Sprache verglich und bemerkte, dass diese nicht übereinstimmten. Mit 11 Jahren lernte er Latein und Griechisch und schrieb sich 1805 in die Akademie der Wissenschaften ein.
Zu seinem Abschluss sollte er eine Rede halten und las anlässlich dazu ein
paar Passagen aus seinem Buch "Ägypten zur Zeit der Pharaonen" vor. Die
anwesenden Professoren waren davon derart angetan, dass sie ihn sogleich als
Mitglied in die Akademie aufnahmen. Mit 19 Jahren erhielt er dort eine Professur
für Geschichte.
Um seine Forschungsarbeiten auszudehnen, reiste er 1828 nach
Ägypten und übertrug die Hieroglyphen, die er dort vorfand, auf Papier zur
späteren Bearbeitung. Nach einem Jahr kehrte er nach Paris zurück und erhielt
den allerersten Lehrstuhl für Ägyptologie.
Am 4. März 1832 verstarb er an
einem Herzanfall, der die Auswirkung seiner jahrelang begleitenden
Ohnmachtsanfälle war.
Champollion hatte den wohl mit Abstand größten Erfolg bei der Entzifferung.
Er setzte sich als ehrgeiziges Ziel, Primus bei der Entschlüsselung
altägyptischer Sprachen zu sein. Um für dieses Ziel gewappnet zu sein, erlernte
er weitere 10 Sprachen (u.a. Hebräisch, Koptisch, Chinesisch). Er übte sich an
Obelisken, die man auf der Nilinsel Philae gefunden hatte. Sie waren auch in
zweisprachiger Darstellung, nämlich auf Griechisch und in Hieroglyphenschrift
und enthielten die Namen Kleopatra
und Ptolemäus.
Diese Ergebnisse konnte er verwenden, um weitaus
schwierigere (einsprachige) Kartuschen zu bearbeiten. Die Hürde der ihm
vorliegenden Schriftzüge bestand darin, dass die Schreiber der damaligen Zeit
ungern Vokale nutzten, in der Annahme, der Leser könne sie aus dem
Textverständnis heraus problemlos einfügen. Dennoch gelang es ihm, den Namen des
wohl bekanntesten Mannes der Antike zu entziffern: Alexander. Doch dieses
Ergebnis untermauerte nur noch mehr Youngs Theorie, was fremdsprachige Namen
betrifft.
Eine Kartusche aus dem Tempel von Abu Simbel, die vor der
griechisch-römischen Herrschaft entstanden war, sollte dem jungen François recht
geben. Sie war alt genug, traditionelle ägyptische Namen zu enthalten, und sie
war fast ausschießlich phonographisch. Die Kombination dieser vier Zeichen, von
denen er die letzten zwei als -s- in alksentrs (Alexander)
übersetzt hatte, beschäftigten sein Gemüt. Er zog in Erwägung, dass das erste
Zeichen ein Symbol für Sonne sein könnte. Ihm kam die Idee das Wort Sonne ins
Koptische zu übersetzen, also als -ra- zu lesen. Mit diesen drei der vier
Zeichen war es nun möglich durch logische Schlussfolgerung von den Silben ra-?-s-s unter Berücksichtigung absichtlich fehlender Vokale den
letzten Buchstaben zu erschließen. Da es sich vermutlich um den Namen eines
Pharaonen handelte, würde durch Einsetzen des vermutlichen Buchstaben -m-
der Name Ramses entstehen. Damit lag er richtig.
Dies
zeigte, dass die Schreiber ihre Texte nach dem Rebus-Prinzip verfassten, indem
sie lange Wörter in einzelne Bestandteile zerlegten, die dann als Ideogramme
dargestellt wurden. Dadurch lässt sich schlussfolgern, dass die Verfasser nicht
Griechisch gesprochen haben, denn dann hätte man Sonne mit helios übersetzt und
dies ergäbe keinen Sinn. Von diesem Erfolg beflügelt, konnte Champollion mühelos
weitere Hieroglyphen übersetzten und beschrieb seine Leistung in seinem Werk
Précis du système hiéroglyphique.
Anderen Wissenschaften, wie beispielsweise
der Linguistik, wurde somit der Weg geebnet, die Entwicklung einer bis dato
vergessengeglaubten Sprache zu erforschen und nachzuvollziehen. Viele Neider
betrachteten seine Arbeit distanziert. Zu den größten Kritikern zählte Thomas
Young.
Ramses Kartusche |
Namenskartusche der Kleopatra auf dem Obelisken aus Phila. Sie enthält 4 Buchstaben, die auch auf der Ptolomäuskartusche erscheinen: P, T, O, L |